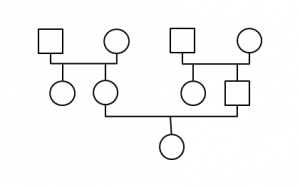Die Feststellung, dass eine ganze Generation der Liebe nicht fähig sein soll, liegt gerade im Trend. Meistens geht es dann um die Generation Y. Ob erfundenes Konstrukt oder nicht, dieser Begriff spukt in einigen Köpfen über Menschen, die zwischen 1980 und 1995 geboren wurden.
Was ist aus der Generation der eine Millionen Möglichkeiten bezüglich dem großen Begriff Liebe geworden? Autoren wie Michael Nast diagnostizieren ihr Beziehungsunfähigkeit. Damit füllt er Hallen. Thirtysomethings jubeln, wenn er sagt, sie würden vor lauter Selbstinszenierung, Selbstoptimierung und Selbstverwirklichung an der Liebe scheitern. Statt Haus, solide Partnerschaft, Kind und Hund wie die Eltern, hat die Generation Y Fitnessstudio-Verträge, Tinder-Dates, lässige Jobs und Selfies. Findet Anklang. Jedoch etwas platt.
Das statistische Bundesamt ist da etwas romantischer: Die Scheidungsrate in Deutschland sinkt seit 2004, Ehen halten zwei Jahre länger als noch vor zwei Jahrzehnten. Was die Generation Y jedoch im Moment treibt, wird erst in einigen Jahren in den Statistiken zu lesen sein. Vielleicht durchbricht sie ja tatsächlich den Trend der sinkenden Scheidungsraten, vielleicht halten ihre Ehen nur bis zum nächsten Tinder-Date.
Die Frage ist, warum eine klassische Partnerschaft mit Liebe und Treue bis ans Lebensende, wie sie übrigens der Generation Y meistens schon nicht mehr vorgelebt wurde, nicht mehr unbedingt als Jackpot unter den Beziehungsformen gilt?
Wahrscheinlich bieten sich schlicht mehr Möglichkeiten. Millionen Möglichkeiten, die alle leichter erreichbar sind als sie es noch für die Eltern waren. Das zeigt der große Teil der Menschen, die als Y-, Why-, Millennial- oder Tinder-Generation mitgelabelt werden. Manche sogar verheiratet. Manche sogar mit Haus, Hund und Kind. Manche werden niemals in einer Partnerschaft leben.
Doch vielleicht gerade aufgrund der zahlreich möglichen Lebensentwürfe schwappt hier und da etwas Wehmut über. Eine junge Journalistin klagte kürzlich in der Onlineausgabe der FAZ in einem Text mit dem Titel: „Warum meine Generation zu blöd für die Liebe ist“: „Wir sind wie Kinder in einem Spielzimmer, das so überfüllt ist, dass wir eine neue Modelleisenbahn brauchen, weil wir die alte nicht mehr finden. Ich wäre gern wie ein Kind, das seinen Teddy auch dann noch liebt, wenn sein Fell an Glanz verliert.“
| Bildquellenangabe: | Esther Stosch / pixelio.de |